China hat dem sich überlegen fühlenden Westen eine Zwickmühle gebaut.
Um präzise zu sein: Es sind mehrere ineinandergreifende Zwickmühlen in verschiedenen Dimensionen. Denken wir an Elektroautos und Chinas Dominanz bei Batterietechnologie. Oder die Seltenen Erden, die sämtliche Aufrüstungspläne im Westen unmöglich machen. Oder die aktuelle Lieferblockade im Nexperia-Drama, welche die nächste Chip-Krise bei den Herstellern ausgelöst hat. Im Nachhinein fragt man sich: Warum haben wir das nicht gesehen und etwas dagegen unternommen?
In einer Reihe von Artikeln möchte ich untersuchen, welche Ideen sowie Informations- und Planungsprozesse für Kapitalallokationen es China ermöglicht haben, Technologien zu entwickeln, die es heute bereits wirtschaftlich dominieren. Warum? Weil China der größte Automarkt der Welt ist und zunehmend unsere Industrie dominiert.
China dominiert heute bereits die Welt.
Dazu braucht es einen unvoreingenommenen Blick. Natürlich wird China in einem Ein-Parteiensystem durch die Kommunistische Partei geführt. Präsident X arbeitet offenbar derzeit mit seinem „inner circle“ von 11 Personen am nächsten 5-Jahresplan.
Es stimmt auch, dass dies in einem Widerspruch zur kapitalistischen Ausrichtung des Landes und dem Kommunistischen Manifest besteht. Doch schon heute ist China die zweitgrößte Volkswirtschaft nach BIP. Beim kaufkraftbereinigten BIP, welches für die Investitionstätigkeit in Infrastruktur, Bildung, Forschung und Militär wichtiger ist, steht China bereits an Nummer eins.
Weltweit.
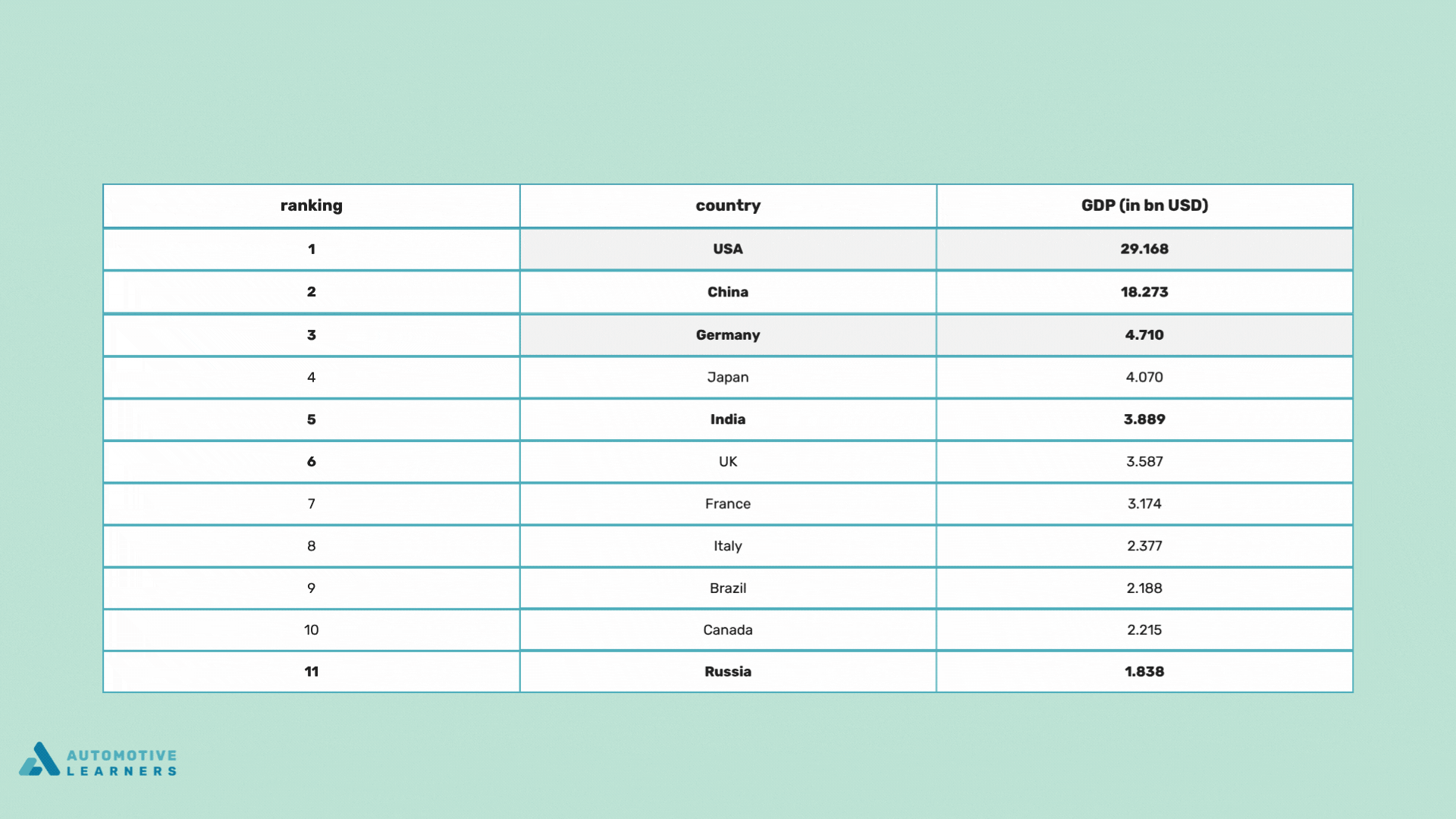
Die Position der G7-Staaten beim kaufkraftbereinigten BIP ist überraschend unterlegen gegenüber der von China, Indien und Russland. Tendenz: China überrascht immer wieder aufs Neue: Am 21. Januar 2025, nachdem Präsident Trump die Investition von 500 Mrd. USD in Künstliche Intelligenz angekündigt hatte, tauchte in der gleichen Woche DeepSeek auf.
Planwirtschaft schlägt Marktwirtschaft? Das kann doch gar nicht sein. Dieser Widerspruch ist himmelschreiend. Irgendetwas stimmt nicht an der Geschichte vom zentralregierten, kommunistischen Land, welches die Freiheit seiner Bewohner einschränkt. Woraus erwächst die Stärke Chinas?
Was macht China anders, als wir das bisher glauben?
Einen Hinweis fand ich in einem Podcast von Lex Fridman. Er interviewte die Professorin der London Business School Keyu Jin. Sie ist die Tochter des früheren Finanzministers Chinas. Sie zog mit 14 Jahren in die USA und arbeitete für die Weltbank, den IMF, die FED und ist heute im Aufsichtsrat von Credit Suisse.
Den folgenschwersten Irrtum, so sagt sie, sei die Annahme, dass alles in China zentral regiert und reguliert sei. Das Gegenteil sei wahr.
Sie berichtet davon, dass die Bürgermeister verantwortlich seien für die gesamthafte Entwicklung ihrer Kommunen. Dies umfasst Aspekte der Infrastruktur, der Bildung, der Sicherheit und insbesondere auch der Wirtschaft.
Chinas dezentrale Bürgermeister-Ökonomie 市长经济
Die Bürgermeister agieren wie die CEOS eines Territoriums. Sie müssen eine Strategie haben, Partnerschaften bilden und Investoren finden, um Industrien anzusiedeln, welche Arbeitsplätze schaffen und den Kommunen Steuern zahlen. Das lokale BIP steht im Fokus. Dabei stehen sie im Austausch und im Wettbewerb. Was in einer Stadt funktioniert, wird in anderen übernommen.
Es wird probiert, was funktioniert, und dann schnell kopiert und skaliert. Wer mehr Wachstum bringt, steigt schneller auf. Es gibt ein klares Performance-Appraisal-System für Bürgermeister, das als 绩效考核 bezeichnet wird.
Die Bürgermeister und ihre Kommunen stehen im Karrierewettbewerb. Wer nicht vorwärtskommt, wer seine Vorgaben nicht erfüllt, wessen Bürger unzufrieden sind, der wird abgesetzt. Und bei Vergehen bestraft.
Wir kennen das Prinzip der Divisionierung eines Unternehmens. Die Profit-Center-Struktur ist ein wichtiges Prinzip in der Unternehmensdivisionierung. Klare Verantwortlichkeiten, eindeutige Messgrößen und eine logische Incentivierung ermöglichen eine dezentrale Steuerung zur Verfolgung eines zentralen Plans.
China spielt Fast Break, der Westen Set Play.
Im Basketball gibt es den sogenannten Fast Break: Sobald ein Team den Ball erobert, sprinten alle Spieler blitzschnell nach vorn, um zu punkten, bevor die gegnerische Abwehr sich formieren kann. Es geht dabei nicht um das perfekte, einstudierte Set-Play, sondern um das schnelle Umschalten – um die sofortige Verwertung jeder sich bietenden Chance.
Diesen Gedanken überträgt Jin auf die chinesische Wirtschaft. Unternehmer und Investoren in China handeln nach demselben Prinzip: Alles, was kurzfristig Umsatz oder Gewinn verspricht, wird ohne Zögern umgesetzt. Geschwindigkeit zählt mehr als Perfektion oder langfristige Planung. Das dahinterstehende Denken lautet: „Lieber zehn Chancen schnell ausprobieren und sechs davon sofort monetarisieren, als eine große Vision langsam und riskant zu verfolgen.“
So steht China wirtschaftlich für das Prinzip des Fast Breaks: hohe Geschwindigkeit, kurzfristige Gewinne, „try & monetize fast“. Der Westen dagegen agiert eher wie beim Set-Play im Basketball – mit längerer Planung, stärkerem Fokus auf nachhaltige Strategien und einer deutlicheren Rolle von Regulierung.
Wir befinden uns im Wettbewerb und viele Wege führen nach Rom.
Wachstum und Wohlstand entstehen aus der Erschließung der menschlichen Erfindungsgabe und Schaffenskraft. Diese kann man durch Bildung veredeln und die richtigen Incentives skalieren. Aber auf jeden Fall braucht es Freiraum für die Entfaltung.
Für uns im Westen bedeutet das 2 Dinge: Das erste ist die Erkenntnis, dass viele Wege zu einem ähnlichen Ergebnis führen. Es ist längst nicht so, dass nur die westliche Demokratie zu Wohlstand usw. führt. Der Systemtheoretiker Ludwig von Bertalanffy bezeichnet das als Äquifinalität: Unterschiedliche Ausgangszustände können zu demselben Endzustand führen. Nicht vergessen: China ist im KPP-BIP bereits Nummer 1 weltweit.
Außerdem befinden wir uns im Wettbewerb, dessen Regeln wir nicht festlegen. Es ist ein Wettbewerb um die größte Wirtschaftsmacht und den umfangreichsten Einfluss. Um die nachhaltigsten Investitionen in Bildung, Infrastruktur und Sicherheit. Selbstverständlich sollte niemand den Ast absägen, auf dem er sitzt. Deswegen sind Naturschutz und Vermeidung von CO₂-Ausstoß für alle Staaten ein bedeutsames Ziel, sowohl im Westen als auch im Globalen Süden.
Und das bedeutet: Lass sie machen. Lasst sie ihren Plan verfolgen. Denn was bleibt uns anderes übrig. Wie können wir davon lernen? Wir sind im Wettbewerb und müssen uns wieder mit wichtigeren Dingen auseinandersetzen als dem Verbot von Plastikstrohhalmen und der Frage, ob es vegane Schnitzel geben darf. Es geht um das große Ganze – wie wir Prioritäten festlegen und worin wir Geld investieren.
Im nächsten Artikel werde ich die zentrale Planung Chinas genauer untersuchen: Wie funktioniert ein 5-Jahresplan Chinas? Die Planwirtschaft der UdSSR und der DDR wird verantwortlich gemacht für den Niedergang beider Staaten.
Die Frage ist: Was machen die Chinesen anders und was können wir daraus lernen?
 Car Industry
Car Industry

 Car Industry
Car Industry
 Change Tools
Change Tools
